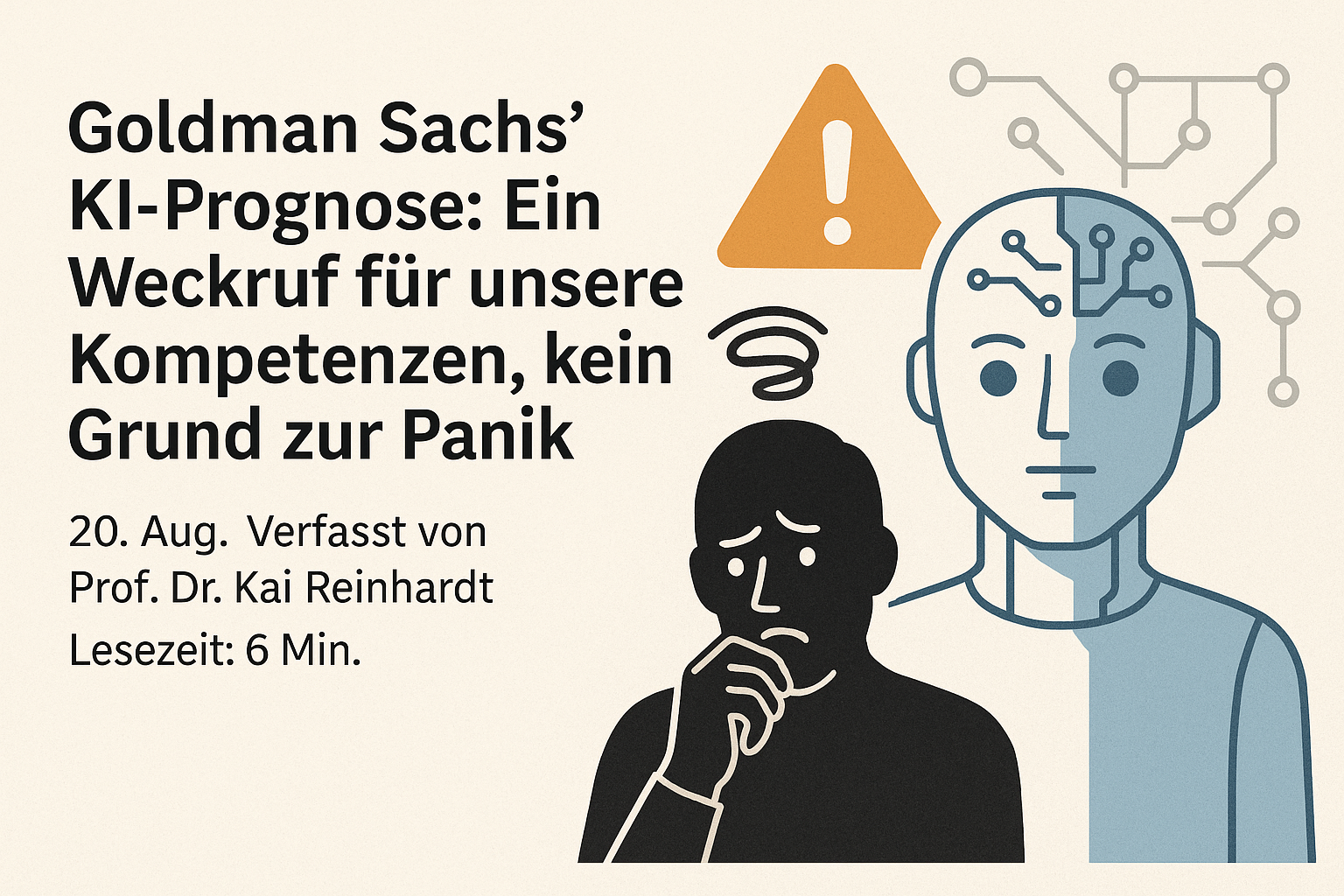Goldman Sachs' KI-Prognose: Ein Weckruf für unsere Kompetenzen, kein Grund zur Panik
Lesezeit: 6 Min.
Es ist eine Schlagzeile, die wie für die Titelseiten gemacht ist: Ein aktueller Report der renommierten Investmentbank Goldman Sachs prognostiziert, dass bis zu 7% der Arbeitsplätze in den USA durch den Vormarsch der Künstlichen Intelligenz gefährdet sein könnten. Solche Zahlen schüren Ängste und befeuern eine Debatte, die oft von Unsicherheit geprägt ist. Doch bei genauerem Hinsehen ist der Report weniger eine apokalyptische Prophezeiung als vielmehr ein wichtiger, datengestützter Indikator für einen Wandel, der längst im Gange ist.
Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht ob sich unsere Arbeitswelt verändert – das hat sie schon immer getan –, sondern wie wir uns intelligent und proaktiv darauf vorbereiten. Was bedeutet diese Transformation konkret für die Fähigkeiten, die wir morgen brauchen, für die Art, wie wir unsere Unternehmen strukturieren, und nicht zuletzt für den fundamentalen Auftrag unserer Hochschulen?
Was der Report wirklich sagt
Die Analyse von Goldman Sachs zeichnet ein differenziertes Bild, das es sich lohnt, genauer zu betrachten, bevor man voreilige Schlüsse zieht:
Die Forscher gehen davon aus, dass eine breite Einführung von KI 6-7% der US-Arbeitsplätze verdrängen könnte. Sie sehen dies jedoch als einen vorübergehenden Effekt, der die Arbeitslosenquote kurzfristig um etwa einen halben Prozentpunkt anheben könnte.
Dieser kurzfristigen Disruption stellen sie eine optimistischere, langfristige Perspektive gegenüber. Sie ziehen einen historischen Vergleich und erinnern daran, dass über 60% der heutigen Berufe im Jahr 1940 noch gar nicht existierten. Das legt nahe, dass, wie schon bei früheren technologischen Revolutionen, auch dieses Mal neue, heute noch unvorstellbare Berufsbilder entstehen werden.
Dennoch sind die ersten Auswirkungen bereits spürbar. Branchen wie Marketing, Grafikdesign und administrative Unterstützung verzeichnen schon jetzt ein verlangsamtes Wachstum. Besonders gefährdet, so der Report, sind Tätigkeiten, die repetitiv und regelbasiert sind, wie die von Programmierern, Buchhaltern oder Rechtsassistenten. Als deutlich sicherer gelten hingegen Berufe, die auf komplexem menschlichem Urteilsvermögen basieren, wie die von Führungskräften, Radiologen oder Fluglotsen.
Meine Perspektive als Forscher: Die drei entscheidenden Handlungsfelder
Die Zahlen des Reports sind ein wichtiger Indikator, doch die eigentliche Arbeit beginnt erst bei ihrer Interpretation. Aus meiner Sicht beleuchtet der Report drei zentrale Handlungsfelder, auf die wir unsere Energie konzentrieren sollten:
1. Das Ende der Jobprofile, der Beginn des Kompetenzmanagements: Der Report bestätigt auf eindrucksvolle Weise, was meine Forschung seit Jahren zeigt und was ich in Büchern wie "Kompetenzmanagement in der Praxis" detailliert beschrieben habe: Klassische, in Stein gemeißelte Jobprofile verlieren rasant an Bedeutung. An ihre Stelle tritt die Notwendigkeit, dynamische Kompetenzen zu fördern. Die von Goldman Sachs als "sicher" eingestuften Jobs erfordern genau jene "Future Skills", die schwer zu automatisieren sind: komplexes Problemlösen, Kreativität, emotionale Intelligenz und vor allem die Fähigkeit zur Mensch-KI-Kollaboration. Für Unternehmen bedeutet das ganz konkret: Wer jetzt nicht in ein strategisches und agiles Kompetenzmanagement investiert, um genau diese Fähigkeiten systematisch zu identifizieren und zu fördern, verliert den Anschluss.
2. Der Weckruf für die Hochschulentwicklung: Wenn über 60% der heutigen Berufe vor 85 Jahren noch nicht existierten, mit welcher Berechtigung bilden wir dann heute noch primär für die bekannten Berufe von gestern aus? Die Analyse von Goldman Sachs ist ein unmissverständliches Mandat für eine radikale Weiterentwicklung unserer Curricula. Hochschulen müssen sich von reinen Wissensvermittlern zu Kompetenz-Schmieden wandeln, die Anpassungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet konkret: weniger Frontalunterricht, mehr interdisziplinäre Projektarbeit an realen Problemen. Wir müssen Studierende befähigen, mit Unsicherheit umzugehen und KI nicht als Bedrohung, sondern als souveränes Werkzeug zu nutzen, um klügere Fragen zu stellen. Das ist die Kernaufgabe eines modernen "Hochschulentwicklers".
3. Die Notwendigkeit der resilienten, hybriden Organisation: Die Disruption trifft laut Report zuerst kreative und administrative Rollen. Dies zwingt Unternehmen, ihre Organisationsmodelle fundamental zu überdenken. Die zentrale Frage ist nicht mehr "Mensch oder KI", sondern wie eine "hybride" Organisation aussieht, in der Mensch und Maschine ihre jeweiligen Stärken optimal ausspielen. Es geht nicht darum, Menschen durch Algorithmen zu ersetzen, sondern darum, Arbeitsprozesse so neu zu gestalten, dass KI als "digitaler Kollege" oder "Co-Pilot" agiert, der Freiräume für anspruchsvollere, kreativere und strategischere Aufgaben schafft. Wahre organisationale Resilienz entsteht nicht durch das Festhalten an alten Strukturen, sondern durch die bewusste Gestaltung dieser neuen, kollaborativen Wertschöpfungsmodelle.
Meine Position: Wir stellen die falschen Fragen
Die öffentliche Debatte, befeuert durch Reports wie den von Goldman Sachs, kreist obsessiv um eine einzige Zahl: die Prozentzahl der Arbeitsplätze, die verloren gehen. Das ist eine gefährliche Vereinfachung, die uns vom Wesentlichen ablenkt.
Das eigentliche Risiko ist nicht die KI-Automatisierung. Die eigentliche Krise ist unsere Trägheit. Wir blicken auf die Technologie und übersehen die massive Kompetenzlücke, die sich vor uns auftut. Wir bilden in unseren Hochschulen immer noch für die Arbeitswelt von gestern aus und entwickeln in Unternehmen Mitarbeiter für die Aufgaben von heute – nicht für die Herausforderungen von übermorgen.
Die Verantwortung für die Zukunft der Arbeit liegt nicht bei den Entwicklern in Silicon Valley. Sie liegt bei uns: bei den Führungskräften in den Unternehmen, die jetzt mutig in strategisches Kompetenzmanagement investieren müssen, und bei den Hochschulleitungen, die den Mut haben müssen, Curricula radikal zu erneuern.
Die Zukunft gehört nicht denjenigen, die KI fürchten, sondern denen, die lernen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Es geht nicht um die Rettung alter Jobs, sondern um die Gestaltung völlig neuer Wertschöpfungsmodelle. Hören wir auf, über das Problem zu lamentieren. Fangen wir an, die Lösung zu bauen.
Quelle: https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-will-ai-affect-the-global-workforce