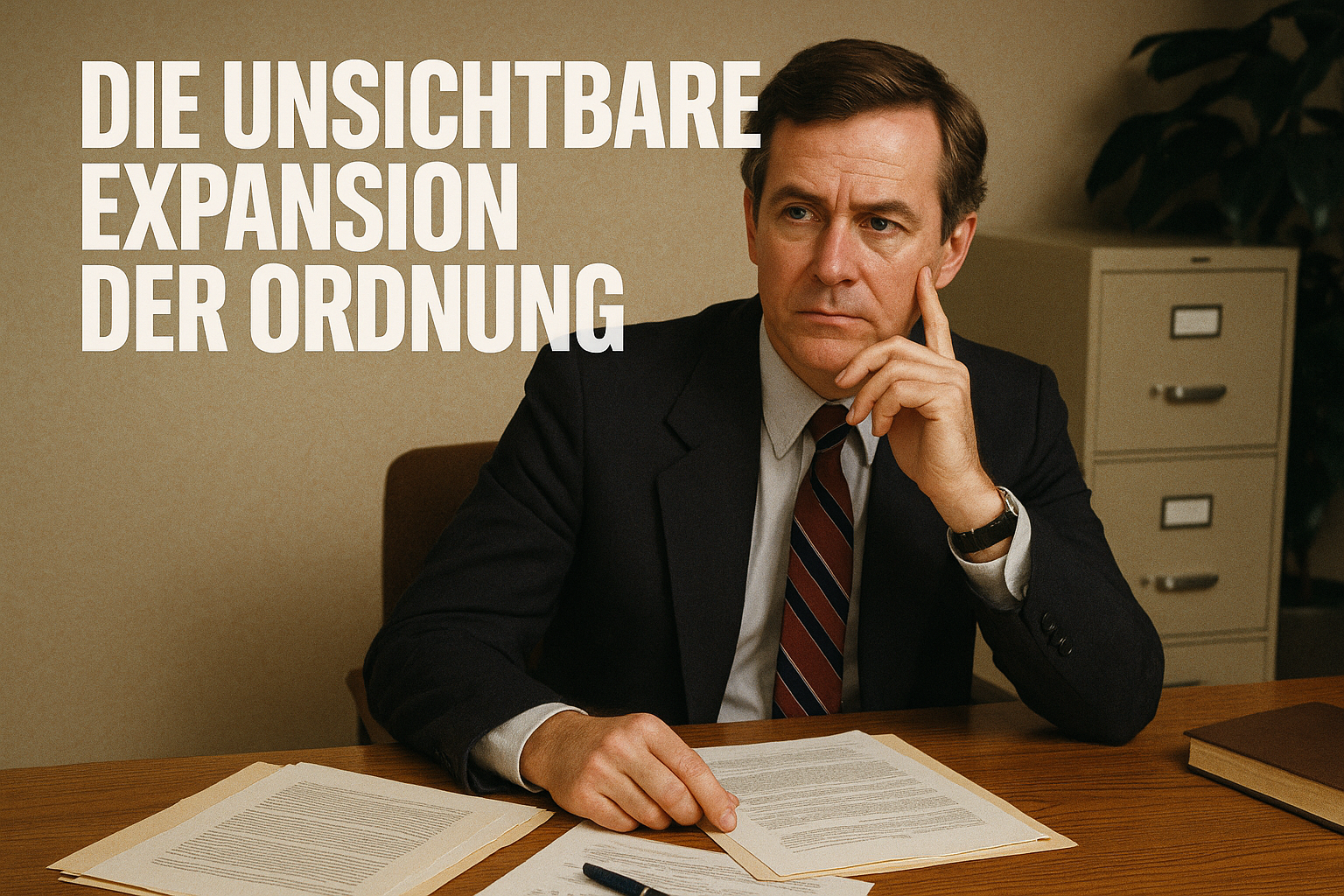Die unsichtbare Expansion der Ordnung: Ein radikaler Blick auf das, was Organisationen wirklich zusammenhält
Der aktuelle Diskurs in der Organisationstheorie ist maßgeblich von Konzepten wie Agilität, Netzwerkorganisation und dem postulierten Ende bürokratischer Strukturen geprägt. In diesem intellektuellen Umfeld stellt der Aufsatz „Resurrecting organization by going beyond organizations“ von Göran Ahrne, Nils Brunsson und David Seidl (2016) eine bemerkenswerte und thesenstarke Intervention dar. Er kehrt die gängige Annahme, wir erlebten eine generelle Abnahme formaler Organisation, radikal um. Die Autoren postulieren stattdessen eine beispiellose Expansion von Organisation, die sich lediglich in neuen, oft weniger sichtbaren Formen manifestiert.
Ihre zentrale These lautet: Wir erkennen Organisation in ihrer modernen Gestalt nicht mehr, weil unser Blick durch ein tradiertes, auf vollständige, formale Gebilde fixiertes Verständnis getrübt ist. Die folgende Analyse wird diesen ebenso provokanten wie erhellenden Gedanken entfalten und seine tiefgreifenden Implikationen für das Verständnis unserer heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufzeigen.
Die unsichtbare Expansion der Ordnung
In dieser Provokation versteckt sich eine tiefere Wahrheit, die zur Umkehrung einiger heutiger Argumentationslinien führt: Während der moderne Managementdiskurs das Verschwinden von starrer, rigider Organisation – weg vom „administrativen“ Verständnis – und die Zukunft in dezentralen Netzwerken und freien Märkten sieht, halten die Autoren dagegen: Sie sagen, dass dies nicht weniger, sondern mehr Organisation als je zuvor bedeutet. Der entscheidende Punkt ist, dass Organisation in neuen, oft unscheinbaren und fragmentierten Formen auftritt. Die Organisation hat als Konzept in der heutigen Zeit nicht abgedankt, sie hat lediglich ihr Erscheinungsbild verändert und ihre Einflusssphäre massiv ausgeweitet.
Die Autoren beschreiben diesen Wandel als eine zweifache Bewegung: Zum einen als Expansion und Verlagerung des Organisationsverständnisses. In einer globalisierten Welt, so ihre Beobachtung, lautet die reflexartige Antwort auf nahezu jedes Problem der Koordination oder Integration „mehr Organisation“. Diese Expansion zeigt sich in mehreren Bereichen eindrücklich: Beispielsweise erwähnen sie die Standardisierung als ein „überwältigendes Phänomen in der modernen Welt“. Ihrer Auffassung nach umfasst die Standardisierung nicht nur Produkte, sondern auch Managementprozesse, ethische Richtlinien wie „Fair Trade“ oder ökologische Vorgaben. Allein die Internationale Organisation für Normung (ISO) hat seit ihrer Gründung über 20.500 Standards hervorgebracht. Jeder dieser Standards ist eine Form der partiellen Organisation. Damit wird das Verhalten über Firmengrenzen hinweg gesteuert, oft ohne die Notwendigkeit einer zentralen Hierarchie.
Sie betonen aber auch den Aufstieg der Meta-Organisationen. Auf internationaler Bühne stieg in den letzten Jahrzehnten die Zahl der so genannten “Meta-Organisationen” – also derjenigen Organisationen, deren Mitglieder wiederum Organisationen sind . Heute sind dies über 10.000 internationale Verbände, die „in fast jedem Bereich des sozialen Lebens eine Schlüsselrolle spielen“. Sie organisieren Branchen, schützen Produzenteninteressen oder koordinieren staatliche Funktionen, vom Umweltschutz bis zur Förderung von Menschenrechten.
Zuletzt sprechen sie von der Organisierung von Märkten und Netzwerken. Selbst Bereiche, die als Inbegriff der Unorganisiertheit galten, werden heute zunehmend “durchorganisationiert”. Zivilgesellschaftliche Organisationen greifen in Märkte ein, indem sie „Regeln für anständige Produkte und Produktionsprozesse aufstellen, Überwachungssysteme in Form von Labels etablieren und Boykotte organisieren“. Gleichzeitig führt der gesellschaftliche Ruf nach „Transparenz, Rechenschaftspflicht und Demokratie“ dazu, dass selbst lose Netzwerke dazu gedrängt werden, sich stärker zu organisieren – etwa durch die Erstellung von Mitgliederlisten oder die Etablierung einer entschiedenen Hierarchie .
Diese Expansion führt gleichzeitig zu einer Verlagerung. Je mehr Ordnung außerhalb der klassischen Unternehmen durch Standards, Regulierungen und Verbände geschaffen wird, desto weniger Raum und Notwendigkeit für interne Organisation bleibt. Ein Unternehmen muss seine internen Prozesse vielleicht weniger rigide gestalten, weil sein Handeln bereits durch ein enges Netz externer, entschiedener Regeln vorstrukturiert ist. Die Autoren bringen es auf den Punkt:
„Obwohl sie sich immer noch als starke und autonome Akteure präsentieren, die sich selbst organisieren, wird mehr und mehr von dem, was sie tun, anderswo entschieden“.
Hier liegt der Kern der These: Wir erkennen diese Flut an Organisation nicht, weil wir immer noch nach dem alten Bild der monolithischen, vollständigen Bürokratie suchen. Stattdessen ist die Organisation heute oft partiell, modular und im „Umfeld“ der Unternehmen angesiedelt . Der Abschied von der alten, sichtbaren Hierarchie ist also nicht das Ende der Organisation, sondern der Beginn ihrer subtilen, aber umfassenderen Präsenz in allen Winkeln unserer Gesellschaft.
Die Praxis bestätigt die Theorie: Beobachtungen aus der digitalen Transformation
Die theoretische Brille, die die Autoren uns anbieten, ist nicht nur eine akademische Fingerübung – sie erweist sich als verblüffend präzises Instrument zur Analyse meiner eigenen Forschungsobjekte. In meiner jahrelangen Auseinandersetzung mit der Digitalisierung von Organisationen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Je tiefer man in die vermeintlich neuartigen Probleme des digitalen Zeitalters gräbt, desto häufiger stößt man auf die zeitlosen, fundamentalen Fragen des organisationalen Designs. Die digitale Welt erfindet die Organisation nicht neu; sie tarnt lediglich ihre klassischen Prinzipien in technologischem Gewand.
Ein Paradebeispiel sind digitale Plattformen. In der populären Wahrnehmung gelten sie als Inbegriff einer neuen, dezentralen und befreiten Ökonomie. Doch wendet man das Analyse-Raster der „entschiedenen Ordnung“ an, zerfällt diese Fassade schnell. Der scheinbar offene Zugang zu Diensten wie Uber, Airbnb oder Lieferando ist in Wahrheit durch strikte, entschiedene Mitgliedschaftsregeln kanalisiert – von Fahrer-Screenings über Host-Verifizierungen bis hin zu detaillierten Nutzungsbedingungen. Ihr Betrieb wird von einem riesigen, permanent aktualisierten Set an entschiedenen Regeln diktiert, das von Preisalgorithmen über Verhaltensrichtlinien bis hin zu den AGB reicht. Das Verhalten der Akteure wird durch algorithmische Systeme und allgegenwärtige Bewertungen lückenlos überwacht und bei Abweichungen unmittelbar sanktioniert – sei es durch die Deaktivierung eines Fahrers oder eine schlechte Bewertung für einen Gastgeber. Und trotz der Rhetorik der „Partnerschaft“ existiert eine unmissverständliche, entschiedene Hierarchie: Der Plattformbetreiber behält die ultimative Macht, die bindenden Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen.
Ähnliche Beobachtungen lassen sich bei agilen Arbeitsmethoden machen. Frameworks wie Scrum, die für ihre Flexibilität und ihren Bruch mit alten Bürokratien gefeiert werden, sind bei genauerem Hinsehen clevere Re-Implementierungen organisationaler Grundelemente. Definierte Rollen wie der „Product Owner“ schaffen eine klare, entschiedene Hierarchie für spezifische Entscheidungsbereiche. Die „Sprints“ unterliegen strengen, entschiedenen Regeln bezüglich Zeit und Prozessabläufen. Das „Daily Stand-up“ ist eine institutionalisierte Form des Monitorings. Auch hier wird also nicht auf Organisation verzichtet, sondern sie wird in kleineren, schnelleren und modulareren Zyklen neu aufgebaut.
Die digitale Transformation führt somit nicht zur Auflösung von Organisation, sondern zu ihrer Metamorphose. Die entscheidende Erkenntnis, die der Artikel liefert, ist das Vokabular, um diese neuen Formen zu erkennen und zu benennen. Sie hilft uns zu verstehen, dass hinter dem Code, den Netzwerken und den Märkten der digitalen Welt die altbekannten Mechanismen einer bewusst gestalteten, entschiedenen Ordnung wirken – nur eben partieller, verteilter und oft unsichtbarer als je zuvor.
Die Grammatik der neuen Organisation
Was ist also die schlussendliche Erkenntnis, die wir aus dem Paper mitnehmen? Die Lektion ist nicht, dass wir eine nostalgische Rückkehr zu den starren Hierarchien des Industriezeitalters erleben oder anstreben sollten. Die wahre Einsicht ist weitaus subtiler und zugleich tiefgreifender:
Um die organisatorische Zukunft zu meistern, müssen wir die zeitlosen Prinzipien der Ordnungsschaffung verstehen, die heute in neuen, oft getarnten Formen wirken.
Der von den Autoren entwickelte Ansatz der „entschiedenen Organisation“ und „partiellen Organisation“ ist der Schlüssel dazu. Er löst den falschen Widerspruch zwischen Struktur und Agilität, zwischen Hierarchie und Netzwerk auf. Er zeigt uns, dass dies keine Gegensätze sind, sondern dass die klassischen Elemente der Organisation – Mitgliedschaft, Regeln, Monitoring, Sanktionen und Hierarchie – heute modular und flexibel eingesetzt werden, um selbst die dynamischsten Systeme zu stabilisieren.
Für meine eigene Arbeit an der digitalen Transformation ist diese Perspektive von entscheidender Bedeutung. Nach fast einem Jahr intensiver Arbeit an der 2. Auflage meines Lehrbuchs „Digitale Transformation der Organisation“ beschleicht mich immer genau dieses ambivalente Gefühl: Je weiter man sich dem Thema Organisation heute nähert, desto ferner scheint es zu rücken und desto komplizierter wird der analytische Rahmen. Das Paper bestätigt, dass die Gestaltung der digitalen Zukunft eine tiefe Kenntnis der organisatorischen Vergangenheit erfordert. Die drängendsten Fragen unserer Zeit – wie wir Plattformen fair gestalten, wie wir globale Zusammenarbeit ermöglichen oder wie wir in agilen Umfeldern Verantwortung definieren – sind im Kern Fragen des organisationalen Designs.
Letztlich stattet uns dieses nette Paper mit nichts Geringerem als einer neuen Grammatik für das Verständnis unserer sozialen Welt aus. Es ermöglicht es uns, wie es die Autoren selbst formulieren, „fundamentale Einblicke in die Funktionsweise unserer Welt zu bieten“. Einer Welt, die nicht weniger, sondern auf intelligentere, komplexere und weitaus umfassendere Weise organisiert ist als je zuvor.
Die Aufgabe besteht darin, diese Organisation zu erkennen und sie bewusst zu gestalten.